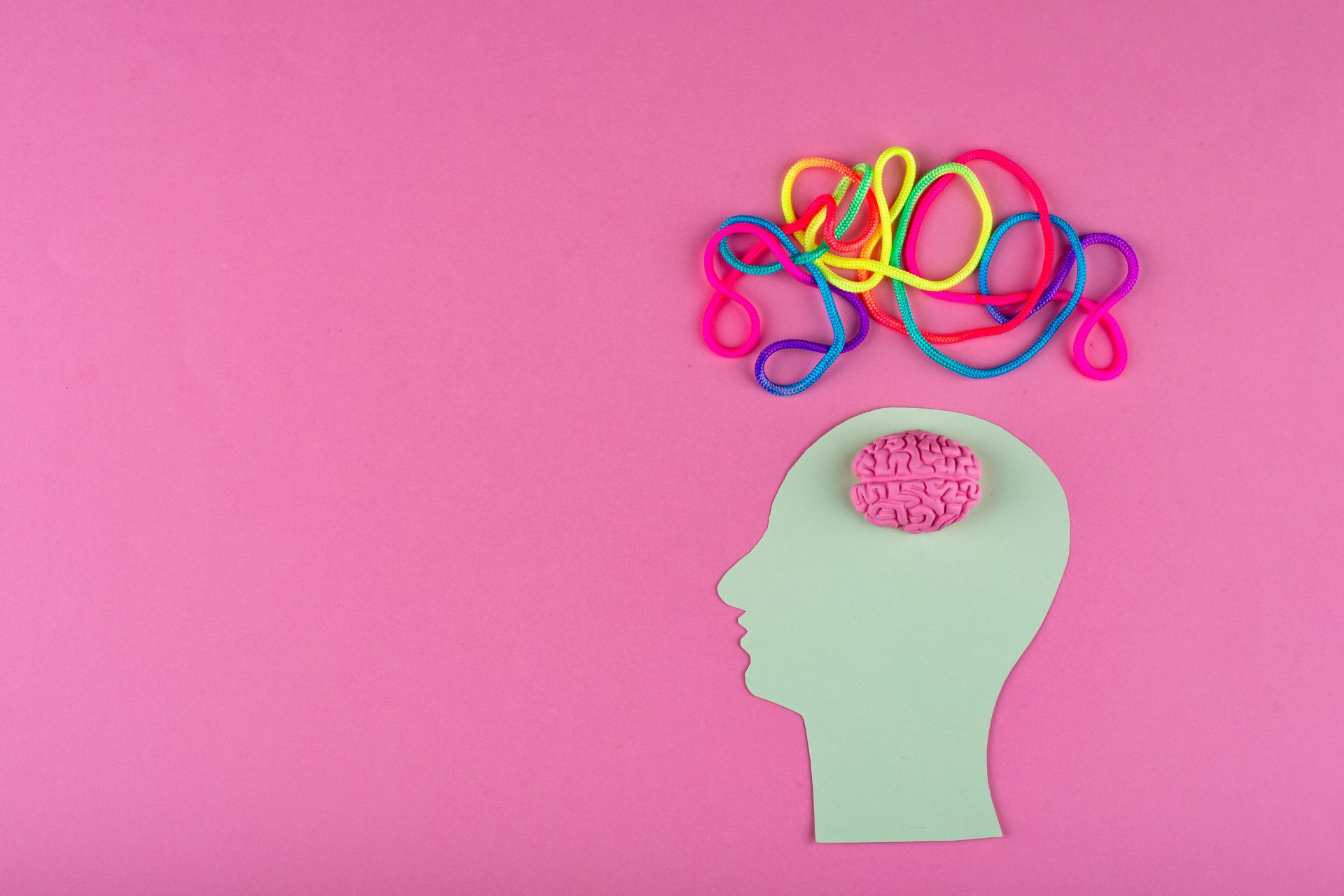Soziale Medien sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Sie verbinden, informieren und unterhalten uns – und doch bringen sie viele Menschen zunehmend aus der Balance. In der psychosomatischen Therapie begegnet uns das Thema fast täglich: Schlafprobleme, Erschöpfung, innere Unruhe, Konzentrationsstörungen oder Konflikte in Beziehungen entstehen häufig im Zusammenhang mit digitaler Dauerpräsenz. Social Media ist damit kein Randthema, sondern spiegelt zentrale Lebensthemen wie Selbstwert, Zugehörigkeit und den Umgang mit Stress wider. Der Wunsch nach Selbstoptimierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Gemeint ist der Drang, sich ständig zu verbessern – sei es das Aussehen, die Fitness, der Erfolg oder das eigene Leben insgesamt. Social Media verstärkt diesen Trend, weil dort ständig neue Maßstäbe gesetzt werden. Der Gedanke, man müsse „besser“, „fitter“ oder „produktiver“ sein, kann zu dauerhaftem Druck führen und verhindert oft, das eigene Leben einfach so anzunehmen, wie es ist.
Der ständige Vergleich – wenn Perfektion zur Last wird
Ein zentrales Phänomen ist der soziale Vergleich. Auf Plattformen wie Instagram oder TikTok sehen wir meist idealisierte Momentaufnahmen: schöne Körper, perfekte Wohnungen, glückliche Beziehungen. Unser Gehirn reagiert darauf mit dem Bedürfnis, sich einzuordnen. Doch wer sein reales Leben mit den besten fünf Sekunden eines anderen vergleicht, fühlt sich schnell unzulänglich. Wenn das bewusst wird, entsteht oft schon Erleichterung. Besonders Jugendliche, deren Selbstbild sich noch entwickelt, leiden unter dieser „Upward Comparison“. Aber auch Erwachsene berichten von subtilen Selbstzweifeln oder dem Gefühl, nie genug zu sein. Warum fällt es uns so schwer, diesen Bildern zu entkommen? Wir tragen ein uraltes, evolutionäres Bedürfnis mit uns: herauszufinden, wo wir im Vergleich zu anderen stehen. In früheren Zeiten machte das Sinn. Heute aber ist es ein permanenter Vergleichskampf, der selten durch reale Begegnung ausgeglichen wird. Likes und Follower wirken wie Wertmaßstäbe, aber objektiv gesehen sind sie das nicht. Rational wissen viele das – doch emotional wirkt es trotzdem. Deshalb ist diese Form der Selbstoptimierung absolut nicht zielführend.
Tipp: Beobachten Sie, welche Gefühle beim Scrollen entstehen. Wenn sich Druck, Neid oder Erschöpfung zeigen, kann eine bewusste Pause guttun. Fragen Sie sich: „Was tut mir gerade wirklich gut?“ Diese achtsame Selbstbeobachtung ist oft der erste Schritt zu mehr innerer Freiheit.
Dauerstress durch Erreichbarkeit und FOMO
Viele Menschen erleben Social Media als ständigen Begleiter. Der Drang, nichts zu verpassen („Fear of Missing Out“), führt dazu, dass das Handy kaum aus der Hand gelegt wird. Kurzfristig beruhigt das Checken von Nachrichten oder Likes, aber langfristig verstärkt es jedoch Unruhe und Erschöpfung.
Neurobiologisch wirken soziale Medien ähnlich wie Glücksspiel: Jeder Like, jede Nachricht aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, kleine Dopamin-Impulse werden freigesetzt – und insbesondere, weil diese Reize unvorhersehbar sind, bleibt das Gehirn in Erwartung. Fachleute nennen das intermittierende Belohnung. Das bedeutet, dass unser Gehirn immer auf Empfang bleibt, weil es nicht weiß, wann wieder etwas angezeigt wird, dass unser Belohnungssystem aktiviert. So kann ein Suchtverhalten entstehen und es führt mittelfristig dazu, dass wir schwieriger mit Impulsen umgehen, weniger Geduld aufbringen. Genau das betrifft Kinder und Jugendliche in besonderem Maße, denn ihre Kontrollmechanismen sind noch nicht vollständig ausgereift. Aber auch wir Erwachsenen reagieren in ähnlichem Maße auf dieses Phänomen.
Tipp: Feste Offline-Zeiten, besonders vor dem Schlafengehen, helfen, den Kreislauf zu durchbrechen. Schon wenige Tage mit klaren Grenzen führen oft zu besserem Schlaf und mehr Ruhe. Vor allem vor dem Schlafengehen sollte die Bildschirmzeit beendet sein. Legen Sie das Handy außerhalb des Schlafzimmers an einen festen Ort. Morgens nach dem Aufstehen empfehlen wir mindestens die ersten 20 Minuten nicht aufs Handy zu schauen.
Die Kraft von JOMO – Joy of missing out
Als Gegenbewegung zu FOMO gewinnt JOMO – die „Joy of Missing Out“ – zunehmend an Bedeutung. JOMO beschreibt die Freude, etwas bewusst zu verpassen: das Handy beiseitezulegen, im Moment zu sein und zu genießen, dass man gerade nicht online ist. Es ist die innere Haltung, die sagt: „Ich muss nicht überall dabei sein – das, was jetzt ist, genügt.“
Diese Haltung entsteht nicht über Nacht. Sie wächst, wenn wir lernen, mit dem eigenen inneren Druck achtsam umzugehen. Viele Menschen bemerken, dass sie beim „Offline-Sein“ zunächst Unruhe oder Angst verspüren, etwas zu verpassen. Doch genau diese Wahrnehmung ist der Beginn einer neuen Freiheit. JOMO bedeutet nicht, sich von der Welt zurückzuziehen, sondern bewusst zu wählen, was uns wirklich nährt. JOMO wächst mit der Erfahrung, dass man auch ohne digitale Reize ganz in sich ruhen kann. Meditation, Yoga oder Naturerlebnisse fördern dieses Empfinden nachhaltig.
Wer JOMO praktiziert, erlebt meist mehr Gelassenheit und Konzentration. Es geht nicht darum, Technik zu meiden, sondern die Beziehung zu ihr bewusster zu gestalten. Das Gefühl, etwas zu verpassen, wird ersetzt durch das Gefühl, bei sich selbst anzukommen.
Social Media bewusst nutzen – statt sich nutzen zu lassen
In der therapeutischen Arbeit fragen wir gezielt nach der Art der Nutzung: Wird Social Media zur Ablenkung, zur Selbstbestätigung oder zum Kontakt mit anderen genutzt? Oft steckt dahinter ein berechtigtes Bedürfnis nach Anerkennung oder Zugehörigkeit. Diese Bedürfnisse zu erkennen und auf andere, nährende Weise zu erfüllen – etwa durch Gespräche, Bewegung oder kreative Tätigkeiten – ist heilsam. Kleine Schritte, wie „digitale Inseln“ im Alltag oder ein „Digital Detox light“, schaffen spürbare Entlastung.
Zahlreiche Studien zeigen Zusammenhänge zwischen problematischer Social-Media-Nutzung und psychischen Beschwerden. So wurde festgestellt, dass passives Scrollen oder übermäßige Nutzung mit verstärkten Symptomen von Depression, Angst und Einsamkeit einhergeht. (Quelle: PubMed 1) Entscheidend scheint nicht allein die Dauer der Nutzung, sondern vor allem die Qualität: Wird Social Media zur Ersatzbefriedigung, bleibt das echte Leben auf der Strecke, nimmt die Konzentration ab, leidet der Schlaf. Besonders relevant: Wenn das Online-Leben das reale Leben beeinträchtigt, wie Schule, Freundschaften, oder Arbeit, dann spricht man von klinischer Relevanz.
Tipp: Beobachten Sie selbst Ihr Nutzerverhalten. Liegt ihr Smartphone auf dem Tisch, wenn Sie sich mit anderen Menschen unterhalten? Schauen Sie immer wieder darauf, auch wenn jemand gerade mit Ihnen spricht? Werden Sie nervös, wenn Sie Ihr Handy nicht bei sich haben? Werden Sie oft darauf hingewiesen, dass sie unaufmerksam sind? Checken Sie als erstes am Morgen nach dem Aufstehen Ihr Handy? Wenn Sie all diese Fragen mit „Ja“ beantworten, dann lohnt es sich, aktiv darüber nachzudenken, ob Sie etwas verändern möchten.
Meditation: Abgrenzung
Wege zu einem gesunden Umgang – praktische Tipps
1. Bewusstes Innehalten:
Reflektieren Sie: Wie oft greifen Sie unbewusst zum Handy? Welche Gefühle tauchen auf, wenn Sie scrollen? Was löst ein bestimmter Post in Ihnen aus? Schon solche Fragen schaffen Klarheit.
2. Digitale Routinen schaffen:
Legen Sie feste Zeiten oder Räume fest, in denen das Smartphone bewusst beiseitegelegt wird (z. B. Schlafzimmer, eine Stunde vor dem Einschlafen). Feste „Handy-freie Inseln“ im Alltag erleichtern das Abschalten und fördern den Schlaf.
3. Qualitative Nutzung statt Quantität:
Nicht jede Form der Nutzung ist gleich belastend. Passives Konsumieren (endloses Scrollen) wirkt nachweislich negativer als aktives Austauschen oder sinnvolle Begegnung. (Quelle: PubMed 2) Stellen Sie sich die Frage: Nutze ich Social Media, um echte Verbindung zu erleben oder nur, um mich abzulenken?
4. Bedürfnisse hinter der Nutzung erkennen:
Häufig stecken Wünsche nach Zugehörigkeit, Anerkennung oder Ablenkung dahinter. Im therapeutischen Prozess arbeite ich gerne daran, diese Bedürfnisse bewusst zu machen und alternative Wege ihrer Erfüllung zu finden – etwa durch echte Begegnung, kreative Aktivität oder Bewegung.
5. Kleine Schritte wagen – „Digital Detox light“:
Schon wenige Tage mit bewusst reduziertem oder gestrecktem Medienkonsum zeigen positive Effekte: besserer Schlaf, mehr Klarheit, weniger Druck. Diese Erfahrung macht oft überzeugender als jede theoretische Erklärung. Studien zeigen, dass Interventionen dieser Art depressive Symptome reduzieren können. (Quelle: PubMed 3)
„Neurobiologisch wirken Soziale Medien wie Glücksspiel. Sie zielen direkt auf unser Dopaminsystem im Gehirn ab. “

Sven Steffes-Holländer Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken
Chancen und bewusste Gestaltung
Trotz der Risiken hat Social Media auch positive Seiten. Viele Menschen erleben dort Gemeinschaft, finden Inspiration oder Unterstützung in schwierigen Lebensphasen. Entscheidend ist die Balance: Wenn digitale Kontakte echte Begegnungen ergänzen und nicht ersetzen, kann Social Media sogar bereichernd sein. Auch ein gesunder Umgang mit dem Wunsch nach Selbstoptimierung gehört im Umgang mit Social Media dazu.
Achtsamkeit, Selbstreflexion und ein bewusster Umgang mit den eigenen Bedürfnissen sind zentrale Wege, um gesund mit Social Media zu leben. Wenn wir lernen, nicht jeder Benachrichtigung sofort zu folgen, sondern wieder zu spüren, was uns wirklich guttut, entsteht Raum für Ruhe, Echtheit und Verbindung – online wie offline.
Weiterführende Inhalte
Die Auseinandersetzung mit der eigenen digitalen Balance kann ein wichtiger Schritt sein, um zu mehr innerer Ruhe und Selbstakzeptanz zu finden. Dabei hilft es, Achtsamkeit nicht als weiteres Optimierungsziel, sondern als Haltung der Präsenz zu verstehen. Lesen Sie dazu auch unsere weiterführenden Beiträge.
Achtsamkeit neu verstehen: Präsenz statt Perfektion
Wie viele Tabs sind offen? – ADHS und das digitale Zeitalter
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren
Neurodivergenz – ein anderer Blick auf Denken und Fühlen
Neurodivergenz eröffnet einen anderen Blick auf Denken und Fühlen. Der Beitrag zeigt, was neurodivergent wirklich bedeutet – jenseits von Etiketten, mit Fokus auf Stärken, Alltag und passende Rahmenbedingungen.
Mein inneres Kind – Ansätze aus der Psychotherapie
Das „innere Kind“ prägt unsere Emotionen und Reaktionen oft stärker, als uns bewusst ist. Erfahren Sie, wie alte Kindheitserfahrungen unser heutiges Verhalten beeinflussen – und wie therapeutische Arbeit hilft, alte Wunden zu verstehen und Heilung zu ermöglichen.
Toxische Beziehungen – ein belastender Kreislauf
Beziehungen mit anderen Menschen können nicht nur Freude, Halt und Liebe bringen, sondern auch eine starke Belastung sein. Besonders schwierig wird es, wenn Machtspiele, Schuldzuweisungen und Distanz den Alltag bestimmen. Hier sprechen wir von toxischen Beziehungen.
Kann man Urvertrauen lernen? – Wie Psychotherapie hilft, Sicherheit neu zu erleben: Ist ein mangelndes Vertrauen gegenüber allem Schicksal, oder kann man das ändern? Kann man Urvertrauen lernen, auch wenn es in der Kindheit gefehlt hat?
Tinnitus verstehen: Ursachen, Behandlung und Tipps für den Umgang
Ein Ohrgeräusch, das nicht mehr verschwindet – Tinnitus betrifft Millionen Menschen. Dahinter steckt oft mehr als nur ein Hörproblem: Körperliche, seelische und psychische Prozesse spielen zusammen. Was bedeutet das für die Behandlung? Und was können Betroffene selbst tun, um besser damit umzugehen?
10 Tipps für einen entspannten Sommerurlaub
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen kann der Sommerurlaub nicht nur angenehm sein. Stress und Erwartungsdruck im Vorfeld sorgen häufig dafür, dass das Wohlbefinden stark leidet. Dann wird der Sommerurlaub zur Tortour anstatt zur ersehnten Entspannung. Mit unseren 10 Tipps für einen entspannten Sommerurlaub sind Sie nicht nur gut auf die heiße Zeit des Jahres vorbereitet, sondern nehmen sich bereits im Vorfeld den Stress raus.